|
Das erweiterte Modell versteht sich als
Kritik an der Unvollständigkeit des ersten Modells. Gleichzeitig weist es
auf Bereiche hin, die für die Linguistik von Forschungsrelevanz sind, will
man eine adäquate Beschreibung von Sprache, ihrer Produktion,
Übermittlung und Verständnis erreichen.
Eine
wichtige Voraussetzung für den Kodierungsprozess ist die strikte Trennung
zwischen Sprach- und Wissensspeicher, die nicht immer selbstverständlich
war. Für Studierende romanischer Sprachen ist es selbstverständlich, dass
der Sprach- und Wissensspeicher zwar miteinander korrelieren, dass aber
die beiden getrennt funktionieren: Auch wenn der Sprachspeicher in
einer gerade neu zu erwerbenden Sprache noch gering ist, auf jeden
Fall geringer als in der Muttersprache, ist doch der
Wissensspeicher davon nicht tangiert. In jüngster Zeit weiß man mehr
über die Abspeicherung von Sprache und Wissensrepräsentationen. Gerade der
Mehrsprachige hat vielfältige netzwerkartige Bahnen zwischen seinem
multilingualen Sprachspeicher und dem Wissensspeicher entwickelt. Das
Faktum, dass Sprach- und Wissenspeicher bei Sender und Hörer grundsätzlich
verschieden gestaltet sind, verdeutlicht, dass eine perfekte Übermittlung
einer Botschaft gar nicht möglich ist. Es gibt also immer nur eine
teilweise Übermittlung und ein partielles Verständnis von dem, was kodiert
und gesendet wird.
Neben dem Sprach- und
Wissensspeicher ist es vor allem die kommunikative Intention - ein Gebiet,
mit dem sich die linguistische Pragmatik heute beschäftigt - und auf
der Empfängerseite die entsprechende oder divergierende Erwartungshaltung,
die den Kodierungs- wie Dekodierungsprozess entscheidend
beeinflusst.
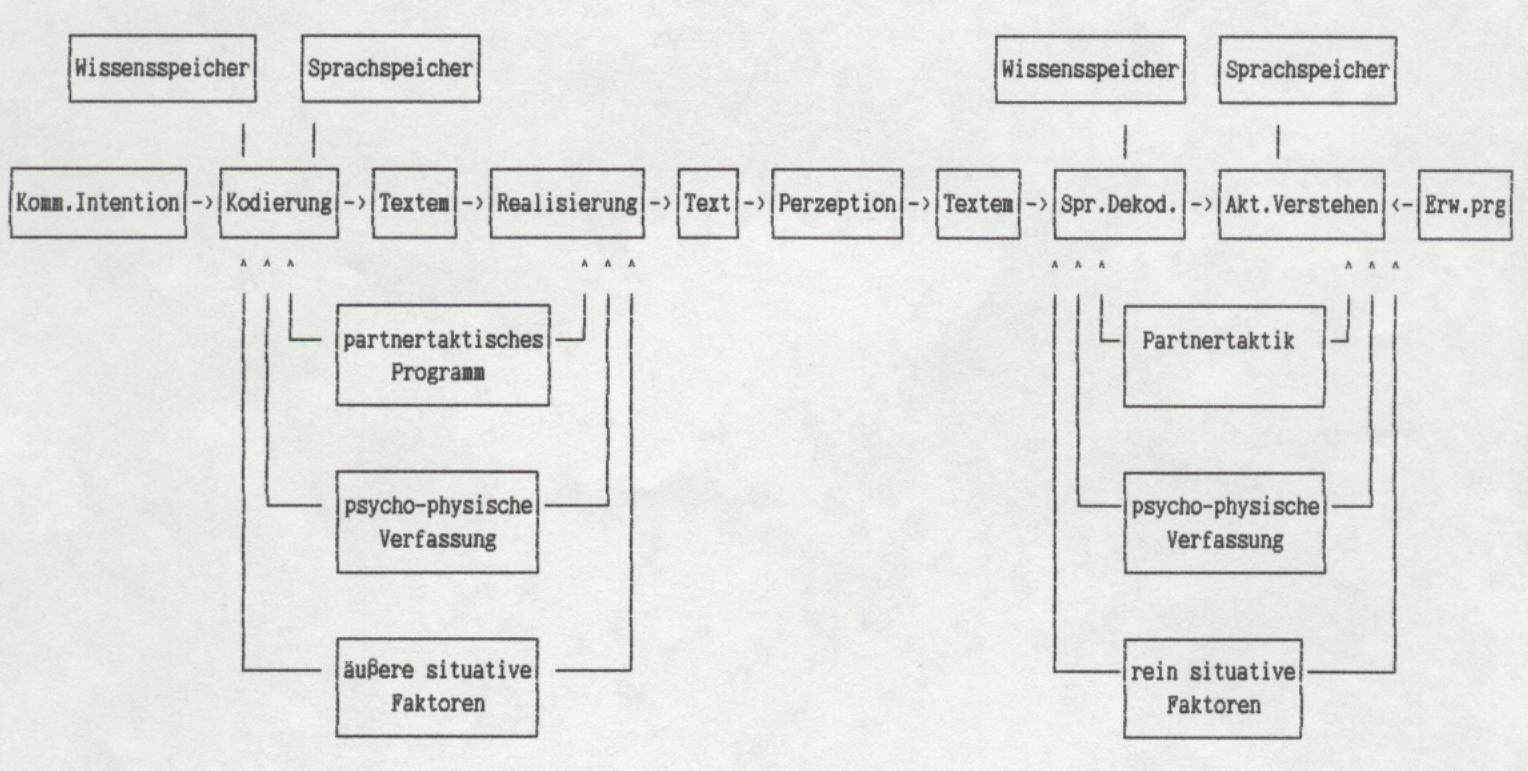
Ferner wird bei diesem Modell deutlich,
welche wichtigen Einflüsse beim Kodierungsprozess eine Rolle spielen. Das
partnertaktische Programm ist dabei ein wichtiges Element aus dem
Sozialverhalten, das deutliche Einflüsse auf den Kodierungsprozess hat.
Man denke an die Möglichkeiten, die Sprachen besitzen, Männlichkeit und
Weiblichkeit zu markieren, soziale Distanz oder Nähe auszudrücken und
ähnliche Phänomene.
Auch die psycho-physische
Verfassung des Senders wie des Empfängers ist von erheblicher
Bedeutung für den kommunikativen Ablauf. In einer angespannten
Prüfungssituation verhält man sich verbal oft anders als in einer
entspannten Alltagssituation. Stressfaktoren bestimmen die Prozesse von
Kodierung und Dekodierung.
Äußere
situative Faktoren schließlich können von entscheidender Bedeutung für den
Gesamtprozess sein. Dabei handelt es sich nicht nur um Lärm,
der kommunikationsstörend sein kann, ein offenes Fenster, der
Klassenraum, die feierliche Atmosphäre bei einem festlichen Ereignis, eine
erotisierende Umgebung, Musik, Narkotika, all diese Phänomene können
Einfluss
nehmen.
Das als Kritik an dem vereinfachten
Modell gedachte Erweiterungsmodell verdeutlicht, dass die Linguistik
zur Deskription von sprachlicher Kodierung eine Vielzahl von
anderen Disziplinen benötigt, mit denen sie kooperieren muss, um eine
adäquate Beschreibung zu erreichen. Hier ist die Geburtsstunde für
die vielen in den 60er und 70er Jahren des vergangenen
Jahrhunderts entstandenen linguistischen Disziplinen zu sehen, die manche
Theoretiker gerne als "Bindestrich-Linguistiken" abgetan haben. Das Modell
zeigt deutlich Bedürfnisse linguistischer Beschreibung auf, es weist auf
die Lücken hin, die sich auftun, wenn man Sprachwissenschaft auf
die Beschreibung des Kodierungs- und Dekodierungsprozesses im Bereich
von Phonetik und Phonolige, Morphemik und Morphologie, Syntax und
Semantik beschränkt. Der nicht zu erreichende Idealfall wäre eine
modellhafte Beschreibung des sprachlichen Kodierungsprozesses als Ablauf, den man
in einem kybernetischen Modell nachvollziehen kann. Sprache wird
dann verstanden als eine menschliche Kodierungsfähigkeit, die in
soziale Gesetzmäßigkeiten eingebettet ist. Dies wurde mit dem Aufkommen
der Soziolinguistik versucht.
|
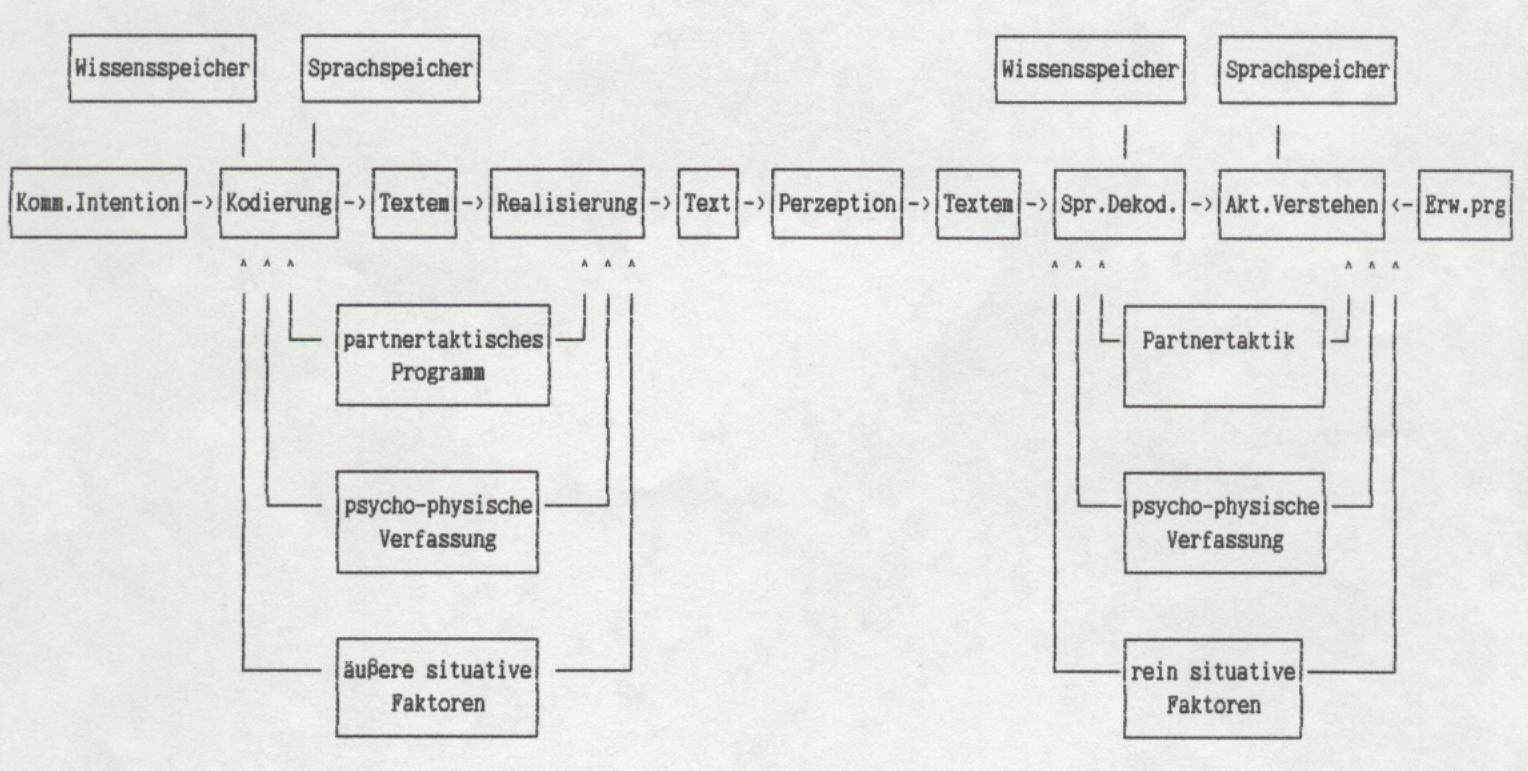
 zurück zur
Textauswahl
zurück zur
Textauswahl zur nächsten
Seite
zur nächsten
Seite